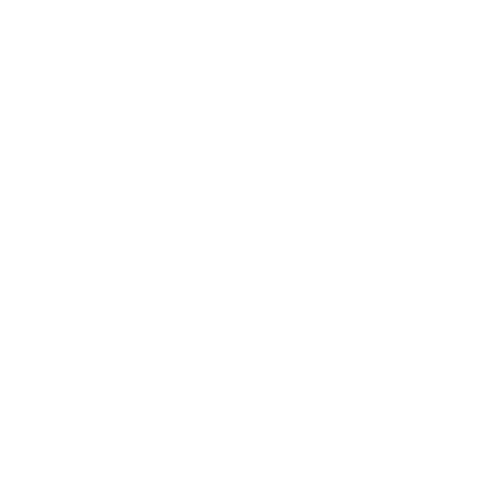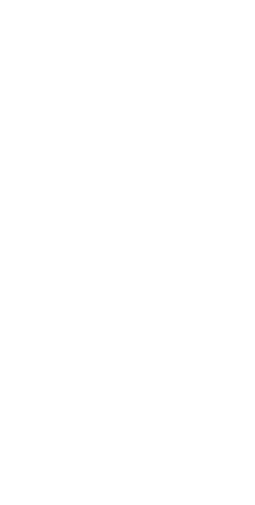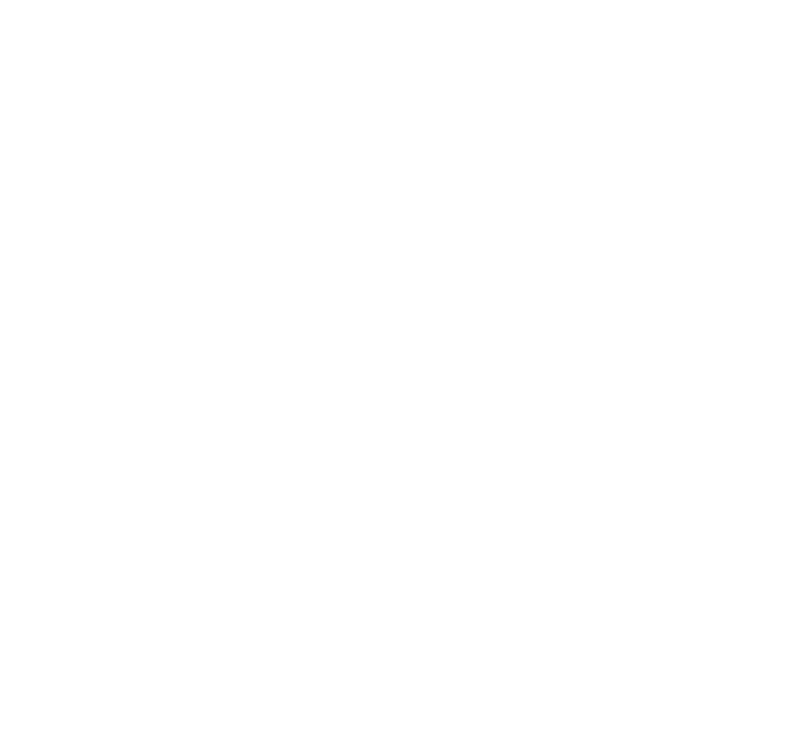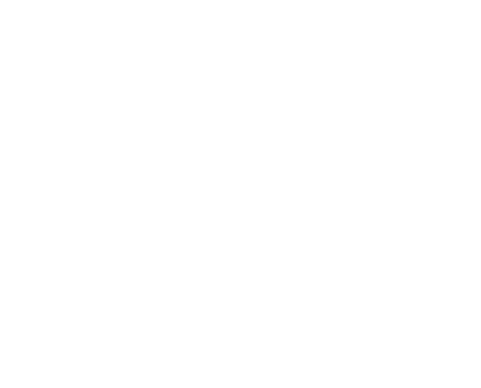Dass sich der Oberbürgermeisterkandidat Ulbig in Sachen Wohnungsbaupolitik an den CDU-Granden Adenauer – „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ – anlehnt, ist wenig verwunderlich, wenn man ehrliche Einsicht oder zumindest Wahlkampfkalkül unterstellen darf. Während der Wohnungsmarkt vor einem Jahr noch „entspannt“ war, das Angebot die Nachfrage überstieg und eine neue Woba letzten November auf Ablehnung stieß, soll nun die neue Woba unter dem Namen ‚Drewo‘ kommen.
Die Gründe für diesen Sinneswandel habe ich gestern mit dem Mitgründer und Vorsitzenden des Dresdner Mietervereins, Peter Bartels, diskutiert. „Woba oder Drewo? Wo wohnt Dresden in Zukunft?“ war der Titel des gestrigen Stadtgesprächs – nach den Berichten zum Wohnungsmangel und der Studie zur ‚Anspannung am Dresdner Wohnungsmarkt‘ ein hochaktuelles Thema. In den letzten Jahren hing der Wohnungsneubau dem kontinuierlichen Wachstum Dresdens weit hinterher. Der Wohnungsleerstand ist dadurch von gesunden 10 Prozent auf 7,6 Prozent gerutscht, wovon wiederum nur etwa die Hälfte marktrelevant, also praktisch vermietbar, ist. (weitere Daten und Zahlen zum Wohnungsbestand finden Sie hier)
Dieser aktuellen Situation ging ein reges Auf und Ab voraus: Von der Wohnungsnot der Wendezeit, über einen Überschuss in der zweiten Hälfte der 90er, hin zu einer mittlerweile enorm wachsenden Auslastung seit dem Verkauf der Woba 2006. Die politische Begleitung zwischen Rückbau und Bauförderung verschwand, zurück blieben allein die Steuerungsinstrumente in den Vertragsauflagen für die Gagfah.
Dass es ganz ohne politischer Beteiligung anscheinend nicht geht und es daher eines städtischen Wohnungsunternehmens bedarf, darüber herrscht in der rot-grün-roten Stadtratskooperation Konsens. Diese städtische Wohnbaugesellschaft würde dabei nicht nur dem dringenden Wohnungsbedarf Rechnung tragen – ein Bedarf der in o.g. Studie auf 2.500 neue Wohnungen pro Jahr beziffert wird –, sondern darüber hinaus auch positive Auswirkungen auf die Stadtentwicklung mit sich bringen. Während der private Markt soziale Aspekte, wie die gesellschaftliche Durchmischung, kaum berücksichtigt, kann ein städtisches Unternehmen dahingehend Impulse setzen und muss keinen Gewinn erwirtschaften. Ein städtisches Unternehmen spekuliert nicht, sondern kalkuliert und die Mieteinnahmen, die das Niveau der Investitionsmarge nicht übersteigen sollten, bleiben in der Stadt und fließen nicht zum Investor ab.
Natürlich kann auch ein privater Markt sozialverträglich sein. Über die Zeit des Überangebots Ende der 90er schwärmte Peter Bartels förmlich: „Damals waren Vermieter Konkurrenten, da war es schön zu sehen, wie die sozial wurden und um ihre Mieter gekämpft haben“. Da Peter Bartels abseits seiner Rolle als Mietervereinsvorsitzender auch für die SPD im Stadtrat sitzt, ist er nun mit am Hebel, diese ausgeglichene Marktstruktur wiederherzustellen. Die Stadtratsmehrheit hat die Kooperation, nun fehlt ‚nur‘ noch die Einigkeit über die Ausgestaltung der neuen Woba – oder wie auch immer diese dann heißen mag.